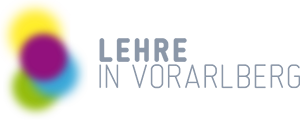Lehre als
Textilchemie
Wie sieht der perfekte Stoff für dich aus? Farbig, weich, wasserfest? Damit ein Stoff all diese Eigenschaften mitbringt, braucht es begeisterte TextilchemikerInnen.
Kurzbeschreibung
Bekleidung soll weich und farbig, Brandschutzanzüge sollen schwer entflammbar, wetterfeste Oberbekleidung soll wasser- und windundurchlässig sein. Um diese Ansprüche zu erfüllen, bleichen, färben und appretieren (= mit Glanz und Festigkeit versehen) TextilchemikerInnen natürliche, künstliche und synthetische Textilfasern, Garne und Gewebe und bedrucken sie mit verschiedenen Textildruckverfahren. Sie richten die Maschinen ein, setzen Behandlungslösungen und Färbebäder an, steuern die Apparate, Kontroll- und Messgeräte und überwachen den Veredelungsprozess.
TextilchemikerInnen arbeiten in Betrieben der Textilindustrie im Team mit ihren KollegInnen sowie mit Fachkräften im Bereich Textiltechnik und Chemie.
Tätigkeiten
- Mischungen und Pasten zum Bleichen und Färben textiler Rohmaterialien und zum Bearbeiten der Eigenschaften wie Glanz und Festigkeit ansetzen
- rechnergestützte Maschinen und Anlagen rüsten, bedienen und warten, Produktionsprozesse kontrollieren und optimieren
- Farblösungen aus Farbstoffen und anderen chemischen Zusätzen herstellen, die Farblösung in die Färbemaschine einfüllen und die Lösung erhitzen
- naturfarbene oder gebleichte Stoffe in Färbemaschinen mittels Auszieh- oder Foulardverfahren färben, den Färbevorgang überwachen
- die Farbe durch Dampf, Hitze und Chemikalien fixieren
- Stoffe zum Appretieren und Trocknen weiterleiten
- die Appreturlösung mischen, die Mischung in den Tank des „Foulards“ (Arbeiten an der Foulardmaschine) füllen
- den Spannrahmen auf die benötigte Spannbreite aufziehen, die Trockenanlage des Spannrahmens aufheizen (Arbeiten am Spannrahmen)
- die Vorgänge an Foulard und Spannrahmen überwachen und kontrollieren
- Flach- und Rotationsschablonen in der Druckmaschine montieren
- die Maschinenfunktionen programmieren bzw. einstellen, die Druckmaschine in Betrieb nehmen und den Druckvorgang überwachen und kontrollieren
- spezielle Oberflächenbehandlungsverfahren bzw. -veredelungsverfahren anwenden, wie Kalandern (Glätten oder Prägen von Stoffen) oder Gouffrieren (Einprägen von Oberflächenmustern) anwenden
- auftretende Maschinenstörungen beheben
- Laboranalysen wie z. B. Dichtebestimmungen, pH-Wert- und Viskositätsbestimmungen, fotometrische Bestimmungen, Maßanalyse, Wasseranalyse, Faseranalyse durchführen
So viel wirst du in etwa verdienen
805-860
1. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
981-1.012
2. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
1.221-1.247
3. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
1.358-1.533
4. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
Anforderungen
Jeder Beruf erfordert ganz spezielle Sach- und Fachkenntnisse, die in der Ausbildung vermittelt werden. Daneben gibt es auch eine Reihe von Anforderungen, die praktisch in allen Berufen wichtig sind. Dazu gehören: Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit, genaues und sorgfältiges Arbeiten, selbstständiges Arbeiten, Einsatzfreude und Verantwortungsbewusstsein. Auch die Fähigkeit und Bereitschaft mit anderen zusammen zu arbeiten (Teamfähigkeit) und Lernbereitschaft sind heute kaum noch wegzudenken.
Welche Fähigkeiten und Eigenschaften in DIESEM Beruf sonst noch erwartet werden, kann von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich sein. Die folgende Liste gibt dir einen Überblick über weitere Anforderungen, die häufig gestellt werden.
Denk daran: Viele dieser Anforderungen sind auch Bestandteil der Ausbildung.
Körperliche Anforderungen: Welche körperlichen Eigenschaften sind wichtig?
- gute körperliche Verfassung
- gute Reaktionsfähigkeit
- gutes Sehvermögen
- Unempfindlichkeit gegenüber chemischen Stoffen
- Unempfindlichkeit gegenüber Gerüchen
Sachkompetenz: Welche Fähigkeiten und Kenntnisse werden von mir erwartet?
- chemisches Verständnis
- Gefühl für Farben und Formen
- gute Beobachtungsgabe
- handwerkliche Geschicklichkeit
- systematische Arbeitsweise
- technisches Verständnis
Sozialkompetenz: Was brauche ich im Umgang mit anderen?
- Kommunikationsfähigkeit
- Kundinnen-/Kundenorientierung
Selbstkompetenz: Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen?
- Aufmerksamkeit
- Beurteilungsvermögen / Entscheidungsfähigkeit
- Flexibilität
- Kreativität
- Sicherheitsbewusstsein
- Umweltbewusstsein
Berufsschulen
Ihre aktuellen Einstellungen bei den Cookie Präferenzen erlauben es nicht, die Karte zu laden. Wenn Sie die Karte sehen wollen, bitte akzeptieren Sie die funktionellen Cookies in Ihren .
Landesberufsschule Dornbirn 2
Eisplatzgasse 5
6850 Dornbirn
FAQs
Was oder wer ist ein Ausbilder?
In deinem Lehrbetrieb gibt es eine oder mehrere Personen, die dich durch deine Lehrzeit begleiten und dir alles lehren, was es in deinem Lehrberuf zu lernen gibt. Diese Personen Mitarbeiter nennt man Ausbilder. Sie haben eine Prüfung abgelegt und geben ihr Wissen und ihr Können an dich weiter. Sie sind für dich aber auch eine wichtige Bezugsperson während deine Lehrzeit: Bei Problemen oder Fragen kannst du dich immer an sie wenden.
Was verdiene ich in meinem Lehrberuf?
Dein Lehrlingsgehalt ist in einem Kollektivvertrag geregelt. Wenn es bei deiner Ausbildung keinen Kollektivvertrag gibt, wird die Lehrlingsentschädigung im Lehrlingsvertrag vereinbart. In jedem Jahr deiner Lehrzeit steigt dein Gehalt an. Unter dem Menüpunkt „Lehrberufe“ findest du bei jedem Lehrberuf dein Gehalt je nach Lehrjahr. Bitte beachte, dass dies dein Lohn, je nach Betrieb und deinem Arbeitsbereich variieren können.
Wie kann ich mich für das Bewerbungsgespräch vorbereiten?
Übe Zuhause mit deiner Familie und oder Freunden das Vorstellungsgespräch. Informiere dich genau über das Unternehmen und deinen Lehrberuf. Überlege dir auch welche kritischen Fragen gestellt werden könnten, damit du darauf gute Antworten hast und nicht zu überrascht bist.
Muss ich beim Bewerbungsgespräch wirklich einen Anzug tragen?
Das hängt ganz von dem Unternehmen und der Lehrstelle ab, für die du dich bewirbst. Nicht zu jeder Lehrausbildung passt ein Anzug! Denk daran: Wie du dich kleidest, sagt viel über dich aus und bietet dir eine Möglichkeit, dich selbst zu repräsentieren.
Was ist eigentlich ein Motivationsschreiben?
Das Motivationsschreiben bzw. Bewerbungsschreiben ist Teil deiner Bewerbungsunterlagen. In deinem Motivationsschreiben machst du dem Betrieb klar, warum genau du der/die Richtige für die Lehrstelle bist. Wenn du dich im Vorhinein über das Unternehmen schlau machst, fällt dir das Schreiben bestimmt einfacher. Gib dein Motivationsschreiben vor dem Absenden am besten einem Erwachsenen zum Korrekturlesen – eine gute Bewerbung ist vor allem fehlerfrei!
Wie finde ich offene Lehrstellen?
Alle Ausbildungsbetriebe findest du unter dem Menüpunkt „Lehrbetriebe“. Hier siehst du auch gleich welche Betriebe in welchen unterschiedlichen Lehrberufen ausbilden. Du kannst dir die Websites der Betriebe anschauen, die dir gefallen und oft findest du dort auch offene Lehrstellen. Aber auch auf anderen Wegen findest du offene Lehrstellen: In den Berufsinfozentren (BIZ Bregenz, BIZ Feldkirch, BIZ Bludenz ), bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer, bei der Lehrlings- und Jugendabteilungen der Arbeiterkammer und im BIFOInformationszentrum Dornbirn kannst du dich über offenen Lehrstellen informieren. Oft findest du auch Stelleninserate in der Zeitung oder aber Familienmitglieder und Freunde wissen über offene Lehrstellen in einer Firma Bescheid. Wenn möglichst viele Personen wissen, dass du auf Lehrstellensuche bist, können sie dich bei deiner Suche unterstützen. Sollte es nicht klappen, erkundige dich beim BIFO nach der Möglichkeit des Jugendcoachings – hier hilft dir dein persönlicher Coach bei der Lehrstellensuche.
Arbeitsbereiche
„In meinem Lehrberuf behandle ich Textilien, damit sie ihr modernes Aussehen erhalten. Meine Aufgabe besteht darin, die Textilien in Qualität und Komfort zu verbessern und neue Materialien zu entwickeln. Ich arbeite im Labor, wo die Rezepte und Verfahren für die anschließende Produktion festgelegt werden und führe Materialbestimmungen und chemische Analysen durch.“
Philip Eienbach, Lehrling bei Wolford AG, ibw Fotowettbewerb 2007
TextilchemikerInnen bleichen, färben und appretieren (= mit Glanz und Festigkeit versehen) textile Rohmaterialien wie Bodenbeläge, technische Textilien, Bekleidungsstoffe. Durch die verschiedenen Verfahren der Textilverarbeitung erhalten pflanzliche, tierische oder synthetische textile Rohmaterialien die gewünschten Eigenschaften wie Waschechtheit, Knitterfestigkeit, Witterungsbeständigkeit oder Pflegeleichtigkeit. TextilchemikerInnen veredeln die Rohmaterialien entweder in unversponnenem Zustand (als Flocke), als Garn oder als Gewebe, wie bei Web-, Strick- und Wirkwaren.
Durch die arbeitsteilige Organisation in den Industriebetrieben arbeiten TextilchemikerInnen entweder in der Färbeabteilung, in der Appreturabteilung oder im Textildruck. Die Färbeabteilung umfasst den Bereich der Vorbehandlung und Färbung von Rohtextilien; in der Appreturabteilung werden die Textilien mit Glanz und Festigkeit versehen. In der Appreturabteilung arbeiten TextilchemikerInnen am Foulard, an dem die Appretur aufgetragen wird und am Spannrahmen, auf dem die Trocknung erfolgt.
Im Textildruck arbeiten TextilchemikerInnen zum Beispiel als FarbköchInnen oder als MaschinenführerInnen. Als FarbköchInnen stellen sie die für den Druck benötigten Druckfarben und Farbpasten nach genau vorgegebenen Rezepturen her. MaschinenführerInnen sind für den gesamten Druckablauf verantwortlich und meist auf eine bestimmte Druckmaschine spezialisiert. TextilchemikerInnen, die an Rotationsfilmdruckmaschinen (Filmdruck mit Rotationsschablonen) arbeiten, programmieren, bedienen und warten diese Maschinen. Sie sorgen für die richtige Farbzufuhr und die richtige Farbabmischung.
TextilchemikerInnen prüfen im Labor die Echtheit und Qualität der Stoffe (sowohl die Ausgangsmaterialien als auch die hergestellte Ware). Sie überprüfen die pH-Werte, führen Dichte- und Viskositätsbestimmungen sowie Wasser- und Faseranalysen (Feststellung von Faserschäden) durch. TextilchemikerInnen stellen Kundenmuster her und entwickeln neue textilchemische Prozesse. Sie überwachen den Produktionsprozess und ersetzen bei Störungen Maschinenteile.
Bei all ihren Arbeiten legen TextilchemikerInnen besonderes Augenmerk auf umweltschonende und energieeffiziente Arbeitsmethoden und Materialverwendung und sorgen dafür, dass Sicherheits- und Qualitätsstandards genau eingehalten werden.
Arbeitsumfeld
TextilchemikerInnen arbeiten in Werkhallen von Großbetrieben der Textilindustrie mit betriebseigener Veredelungsabteilung oder in industriellen Veredelungsbetrieben (z. B. Appreturanstalten, Bleichereien, Imprägnieranstalten, Rauereien, Textildruckereien, Textilfärbereien, Stofffärbereien, Walkereien), die eigene veredelte Gewebe an Großkunden oder Stoffhändler weiterverkaufen oder Textilwaren im Auftrag anderer Textilunternehmen behandeln. Der Großteil der Textilbetriebe ist in Westösterreich angesiedelt, insbesondere in Vorarlberg.
TextilchemikerInnen arbeiten im Team mit ihren KollegInnen, mit Fachkräften im Bereich Textiltechnik, siehe °Textiltechnologie (Lehrberuf)# sowie mit Fachkräften im Bereich Chemie, siehe z. B. °ChemikerIn#, °Chemieverfahrenstechnik (Lehrberuf)#.
Arbeitsmittel
TextilchemikerInnen hantieren mit verschiedenen natürlichen und künstlichen Stoffen, Geweben und Garnen und behandeln diese mit Färbemitteln und unterschiedlichen chemischen Substanzen, die sie nach vorgegebenen oder selbst erstellten Rezepturen zusammenmischen. Sie arbeiten an Färbemaschinen, an Textildruckmaschinen und am Foulard (Maschine zum Auftragen der Appretur), die zum Teil computergesteuert sind (CAD-Anlagen), rüsten diese, reinigen und warten sie. Dazu verwenden sie Schmiermittel, Öl und verschiedene Reinigungslösungen. Im Labor setzen sie Analyse- und Prüfgeräte wie z. B. Mikroskope ein.
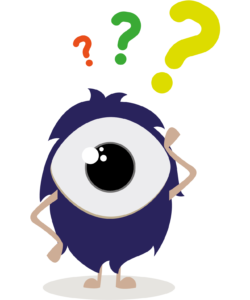
Lehre und Matura?
Vielleicht doch etwas anderes
Applikationsentwickler/in – Coding
Apps nicht nur nutzen, sondern auch entwickeln und programmieren? Einer der gefragtesten und flexibelsten Jobs wartet auf dich!
Fertigungsmesstechnik – Produktionssteuerung
Die Genauigkeit liegt dir am Herzen: In Zeiten der Automatisierungen bist du in der Fertigungsmesstechnik für die Qualitätskontrolle entscheidend.
Konstrukteur/in – Metallbautechnik
Wenn du etwas planst, ist es immer was größeres: Hallen, Brücken oder Türen sind hier nur einige Beispiele! Hast du also ein Gespür für Handwerk und Computer, bist du hier genau Richtig!
Mechatroniker/in (Modullehrberuf)
Als MechatronikerIn bist du MechanikerIn und ElektrikerIn in einer Person. Du bist somit ein vielseitig einsetzbare Allroundtalent in allen Industriebetrieben.
Metalltechnik (HM Schmiedetechnik)
Mit Hammer und Flamme zauberst du ein handgeschmiedetes Einzelstück! Du als Schmiedetechniker kannst aus einem Stück Eisen ein ganzes Kunstwerk fertigen – vom Kerzenständer bis hin zum Treppengeländer.
Papiertechniker/in
PapiertechnikerInnen verwandeln Holz zu Papier! In unterschiedlichen Arbeitsschritten erstellst du Schreibblöcke, Kartone und sonst noch alles, was man aus Papier so machen kann.