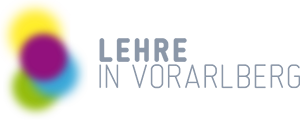Lehre als
Bäcker/in
Wenn es bereits früh am Morgen im ganzen Ort nach frischem Brot duftet, dann war's vermutlich die/der Bäcker*in. Als Bäcker*in arbeitest du mit Hightech-Maschinen sowie mit deinen Händen und versorgst deine KundInnen immer mit dem besten Gebäck.
Kurzbeschreibung
Bäcker*innen mischen bzw. kneten den zur Backwarenherstellung benötigten Teig (Teigherstellung), geben ihm eine bestimmte Form (Tafelarbeit) und backen die geformten Teigstücke (Ofenarbeit). Dieser Beruf verbindet Tradition mit Hightech, denn bei ihrer Arbeit verwenden die Bäcker*innen automatische Knet- und Rührmaschinen sowie vollelektronische Backöfen. In größeren Betrieben setzen sie für die Semmel-, Gebäck- und Broterzeugung halb- und vollautomatische Anlagen, sogenannte Semmel- und Brotstraßen, ein. Bäcker*innen arbeiten gemeinsam im Team mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Sie sind in Backstuben kleiner und mittlerer gewerblicher Bäckereien oder in Produktionshallen von Großbetrieben der Brot- und Backwarenindustrie tätig. Vor allem kleineren Bäckereien haben sie auch direkten Kontakt zu Kundinnen und Kunden.
Tätigkeiten
- Teigmischungen für verschiedene Brotsorten händisch und maschinell herstellen: Mehl sieben und wiegen, mit Wasser, Gewürzen und Zusatzstoffen vermischen
- die Teigmischungen in der Knetmaschine kneten und den Teig ruhen lassen
- die Teige zu Brot, Semmeln, Salzstangerln u. a. Backwaren formen
- die Schleifmaschine bedienen (diese zerteilt den Teig in gleich große Stücke)
- Füllungen für Feinbackwaren herstellen (Strudel, Kipferl, Krapfen usw.)
- die Backstücke auf gefettete Bleche auflegen, die in Metallgestänge gehängt und anschließend in Gärkammern gebracht werden
- das Backgut in vorgeheizte Backöfen einschieben
- die Ofenhitze und den Backvorgang kontrollieren
- das Backgut aus dem Ofen entnehmen, sortieren und in Körbe schlichten
- die Geräte und Maschinen sorgfältig reinigen und für den nächsten Produktionsprozess vorbereiten
- die Qualität sowohl der Roh- und Hilfsstoffe als auch der fertigen Erzeugnisse regelmäßig überprüfen
- Bestellungen von Roh- und Hilfsstoffen durchführen
So viel wirst du in etwa verdienen
617-854
1. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
783-1.098
2. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
1.112-1.586
3. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
1.220-1.708
4. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
Anforderungen
In jedem Beruf brauchst du ganz spezielles fachlisches Know-how, das in der Aus- und Weiterbildung vermittelt wird. In den beiden Menüpunkten Ausbildung und Weiterbildung findest du Informationen, welche fachlichen Kompetenzen in diesem Beruf besonders wichtig sind.
Es gibt auch Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften die in allen Berufen wichtig sind. Dazu gehören besonders:
- Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
- genaues und sorgfältiges Arbeiten
- selbstständiges Arbeiten
- Einsatzfreude
- Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit und Bereitschaft mit anderen zusammen zu arbeiten (Teamfähigkeit)
- Lernbereitschaft
Die folgende Liste gibt dir einen Überblick über weitere allgemeine Anforderungen, die in DIESEM Beruf häufig gestellt werden. Diese können natürlich von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich sein.
DENK DARAN: Viele dieser Anforderungen sind auch Bestandteil der Ausbildung.
Körperliche Anforderungen: Welche körperlichen Eigenschaften sind wichtig?
- Fingerfertigkeit
- guter Geschmackssinn
- Unempfindlichkeit gegenüber Gerüchen
Sachkompetenz: Welche Fähigkeiten und Kenntnisse werden von mir erwartet?
- Anwendung und Bedienung digitaler Tools
- gestalterische Fähigkeit
- gutes Augenmaß
- handwerkliche Geschicklichkeit
Sozialkompetenz: Was brauche ich im Umgang mit anderen?
- Kommunikationsfähigkeit
- Kontaktfreude
- Kund*innenorientierung
Selbstkompetenz: Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen?
- Aufmerksamkeit
- Ausdauer / Durchhaltevermögen
Weitere Anforderungen: Was ist sonst noch wichtig?
- Hygienebewusstsein
- Infektionsfreiheit
Methodenkompetenz: Welche Arbeits- und Denkweisen sind wichtig?
- Kreativität
- Prozessverständnis
- systematische Arbeitsweise
Berufsschulen
Ihre aktuellen Einstellungen bei den Cookie Präferenzen erlauben es nicht, die Karte zu laden. Wenn Sie die Karte sehen wollen, bitte akzeptieren Sie die funktionellen Cookies in Ihren .
Landesberufsschule Feldkirch
Rebberggasse 32
6800 Feldkirch
FAQs
Muss ich mich selber bei der Berufsschule anmelden?
Nein, das macht das Unternehmen für dich, bei dem du die Lehre beginnst.
Was regelt der Kollektivvertrag?
Der Kollektivvertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen dir und deinem Arbeitgeber. Er gilt immer für die ganze Branche, also gibt es beispielweise einen Kollektivvertrag für die komplette Verkaufsbranche. Das garantiert, dass niemand, der in dieser Branche arbeitet nachteilig behandelt wird. Der Kollektivvertrag, der dann zwischen dir und deinem Arbeiter besteht beinhaltet vor allem Regelungen zum Mindestlohn, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und zur Arbeitszeit.
Was muss ich vor dem Bewerbungsgespräch beachten?
Plane am Tag des Bewerbungsgesprächs genug Zeit ein, du solltest niemals zu spät zum vereinbarten Termin kommen. Informier' dich schon vorher wie du am besten zur Adresse des Unternehmens kommst, welcher Bus oder Zug dich dort hinbringt oder wie lange die Fahrt dauert. Achte auf ein gepflegtes Aussehen, lass unbedingt den Kaugummi weg und schalte dein Handy aus. Sollte es passieren, dass du den Termin absagen musst (z. B. weil du krank bist) ruf früh genug bei deiner Ansprechperson im Unternehmen an und verschiebe deinen Termin.
Wie finde ich offene Lehrstellen?
Alle Ausbildungsbetriebe findest du unter dem Menüpunkt „Lehrbetriebe“. Hier siehst du auch gleich welche Betriebe in welchen unterschiedlichen Lehrberufen ausbilden. Du kannst dir die Websites der Betriebe anschauen, die dir gefallen und oft findest du dort auch offene Lehrstellen. Aber auch auf anderen Wegen findest du offene Lehrstellen: In den Berufsinfozentren (BIZ Bregenz, BIZ Feldkirch, BIZ Bludenz ), bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer, bei der Lehrlings- und Jugendabteilungen der Arbeiterkammer und im BIFOInformationszentrum Dornbirn kannst du dich über offenen Lehrstellen informieren. Oft findest du auch Stelleninserate in der Zeitung oder aber Familienmitglieder und Freunde wissen über offene Lehrstellen in einer Firma Bescheid. Wenn möglichst viele Personen wissen, dass du auf Lehrstellensuche bist, können sie dich bei deiner Suche unterstützen. Sollte es nicht klappen, erkundige dich beim BIFO nach der Möglichkeit des Jugendcoachings – hier hilft dir dein persönlicher Coach bei der Lehrstellensuche.
Welche Lehrlingsinitiativen gibt es in meiner Region?
In Vorarlberg gibt es eine Vielzahl von regionalen Lehrlingsinitiativen, die sich in deiner Region für die Lehrlingsausbildung stark machen. Hier findest du eine Übersicht über die verschiedenen Initiativen: • Leiblachtal, www.leiblachtal-erleben.eu • Werkraum Bregenzerwald, www.werkraum.at • Lehre Hofsteig, www.hofsteig.com • Lehrlingsinitiative Lustenau, www.lustenau.at/lehre • Hohenemser Lehrlingsbörse, www.hohenems.at/lehrlingsboerse • EXTRIX Lehre am Kumma, www.extrix.at • WIGE im Vorderland & HeartBeat, www.wige-vorderland.at • Lehre im Walgau, www.lehre-im-Walgau.at • Lehre Montafon, www.lehremontafon.at
Nach dem Bewerbungsgespräch: Was tun, wenn sich niemand meldet?
Erkundige dich nach deinem Bewerbungsgespräch, bis wann du benachrichtigt wirst ob du die Lehrstelle bekommst. Sollte sich bis dahin niemand bei dir melden, kannst du im Unternehmen anrufen und dich höflich erkundigen.
Arbeitsbereiche
Bäcker*innen arbeiten in handwerklichen Betrieben (Bäckereien) oder in Großbetrieben der Brot- und Backwarenindustrie. Sie stellen nach Rezept verschiedene Backwaren und Brotsorten wie z. B. Roggenbrot, Mischbrot, Weizenbrot oder Spezialbrote (z. B. diverse Vollkornbrotsorten) her. Weiters backen sie auch Semmeln und Formgebäck, Feinbackwaren, Kuchen, Dauerbackwaren wie Zwieback, Hart- und Weichkekse, Salz- und Käsegebäck oder diverse Striezel. Spezielle Arbeitsbereiche sind z. B. Biobackwaren oder Diätbackwaren.
Bäcker*innen wählen die Rezepturen und verschiedenen Zutaten aus (Roh- und Hilfsstoffe wie Mehl, Wasser, Eier, Hefe, Backmittel, Milch, Salz, Zucker, Honig, Früchte, Gewürze usw.), wägen und messen diese gemäß den Rezepturen ab und stellen die Teige her, die sie dann maschinell, teilweise aber auch noch von Hand zu den verschiedenen Backwaren formen. Die Bäcker*innen überwachen den Gärvorgang, die Teiglockerung und Teigruhe. Sie stellen Überzüge und Füllungen für die Backwaren her, backen das Brot und Gebäck und glasieren, füllen, zuckern die fertigen Backwaren und das Feingebäck.
Die fertigen Produkte müssen sachgerecht gelagert und die eingesetzten Maschinen und Geräte sorgfältig gereinigt und gepflegt werden. Bei allen ihren Arbeiten achten Bäcker*innen genau auf die Einhaltung von Sicherheits- und Hygienevorschriften.
Bei kleineren Bäckereien werden die frischen Produkte in der hauseigenen Bäckerei oder Konditoreien und über den lokalen Lebensmittelhandel oder auch an die lokale Hotellerie und Gastronomie verkauft. Im Bereich der industriellen Produktion werden die Waren von Lieferanten an unterschiedliche Geschäftsstellen ausgeliefert.
Arbeitsumfeld
Bäcker*innen arbeiten in Backstuben oder in Produktionshallen (z. B. in Großbäckereien). In kleineren Bäckereien sind sie auch in den Verkaufsräumen tätig. Bäcker*innen arbeiten gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen sowie – je nach Betrieb – mit anderen Fachkräften aus dem Lebensmittelbereich – siehe auch °Konditorei (Zuckerbäckerei) (Lehrberuf)#, °Lebzelter*in und Wachszieher*in (Lehrberuf)#, °Lebensmitteltechnik (Lehrberuf)# zusammen. In Großbetrieben arbeiten sie auch gemeinsam mit Backtechnologinnen und -technologen (siehe °Backtechnologie (Lehrberuf)#), und mit Prozesstechniker*innen die für die Wartung und Einstellung der Produktionsmaschinen und -anlagen zuständig sind. Je nach Größe und Art des Betriebes stehen sie in Kontakt mit Kundinnen/Kunden und Lieferant*innen.
Die Arbeit von Bäcker*innen beginnt meist sehr früh, oft auch Mitten in der Nacht, damit die Kundinnen/Kunden bereits zum Frühstück frisches Brot und Gebäck auf den Tisch bekommen. Bäcker*innen arbeiten viel im Stehen. Der Umgang mit Lebensmitteln verlangt außerdem ein besonderes Hygienebewusstsein.
Arbeitsmittel
Bäcker*innen arbeiten mit den jeweils notwendigen Rezepturen und Bestandteilen des herzustellenden Produktes (Mehl, Eier, Wasser, Marmeladen, Topfen, Früchte, Hefe, Backmittel, Salz, Zucker, Honig, Gewürze, Aromen etc.).
In den Backstuben wird mit Backöfen und Backautomaten, Dampfkammern, Gärschrankanlagen, Kühl- und Tiefkühlanlagen gearbeitet. Für die Herstellung der Produkte verwenden sie unterschiedliche Geräte, wie z. B. Rühr- und Knetmaschinen, Waagen, Schleifmaschinen, Schlagbesen, Spritzbeutel, Rollhölzer, Messbecher und Waagen.
In der industriellen Produktion werden zur Semmel- und Broterzeugung vollautomatische Anlagen, sogenannte Semmel- und Brotstraßen (Semmel- und Brotanlagen), eingesetzt. Sämtliche Arbeitsschritte, vom Teigmischen bis zum Backen werden hier maschinell in einem Arbeitsgang durchgeführt. Die Bäcker*innen steuern und überwachen die (meist computergesteuerten) Maschinen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Produktion.
Ihre aktuellen Einstellungen bei den Cookie Präferenzen erlauben es nicht, das Video zu laden. Wenn Sie das Video sehen wollen, bitte akzeptieren Sie die funktionellen Cookies in Ihren .
Ihre aktuellen Einstellungen bei den Cookie Präferenzen erlauben es nicht, das Video zu laden. Wenn Sie das Video sehen wollen, bitte akzeptieren Sie die funktionellen Cookies in Ihren .
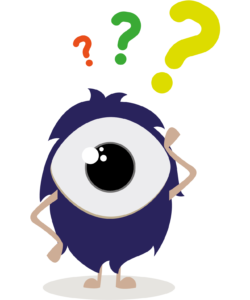
Lehre und Matura?
Vielleicht doch etwas anderes
Entsorgungs- und Recyclingfachmann/-frau – Abwasser
Chemie, Physik und Biologie waren in der Schule deine Lieblingsfächer? Wenn du gerne was für die Umwelt machen möchtest und dir Laborarbeit Spaß macht, dann wirst du als Recyclingfachfrau/mann - Abwasser auf jeden Fall glücklich.
Facharbeiter/in Fischereiwirtschaft
Du gehst gerne angeln und arbeitest gerne mit Tieren? Als FacharbeiterIn für Fischereiwirtschaft stellst du sicher, dass die Fische, die bei uns am Teller landen, gesund sind und gut schmecken.
Holztechnik (Modullehrberuf)
Von Sägewerken bis zur Möbelproduktion – als HolztechnikerIn bist du mit dem Material Holz bestens vertraut und verarbeitest es.
Keramiker/in – Baukeramik
Du möchtest deiner Kreativität Ausdruck verleihen - wie wäre es mit Ton? Als Baukeramiker gestaltest, formst und brennst du Gegenstände Kacheln, Fliesen oder Gefäße.
Luftfahrzeugtechnik
Flugzeuge oder Hubschrauber: Wenn du dich für die Luftfahrt begeisterst, muss es nicht immer einer Pilotenausbildung sein. Als Luftfahrzeugtechniker bist dafür verantwortlich, dass die Flieger und Helis funktionieren und gewartet werden!
Straßenerhaltungsfachmann/-frau
Täglich fahren unmengen von Autos über Straßen. Doch wer sorgt eigentlich dafür, dass sie nicht kaputt geht? Und dass Straßenschilder dort stehen, wo sie stehen sollen? Für genau das sind Straßenerhaltungsfachmänner- und frauen zuständig!